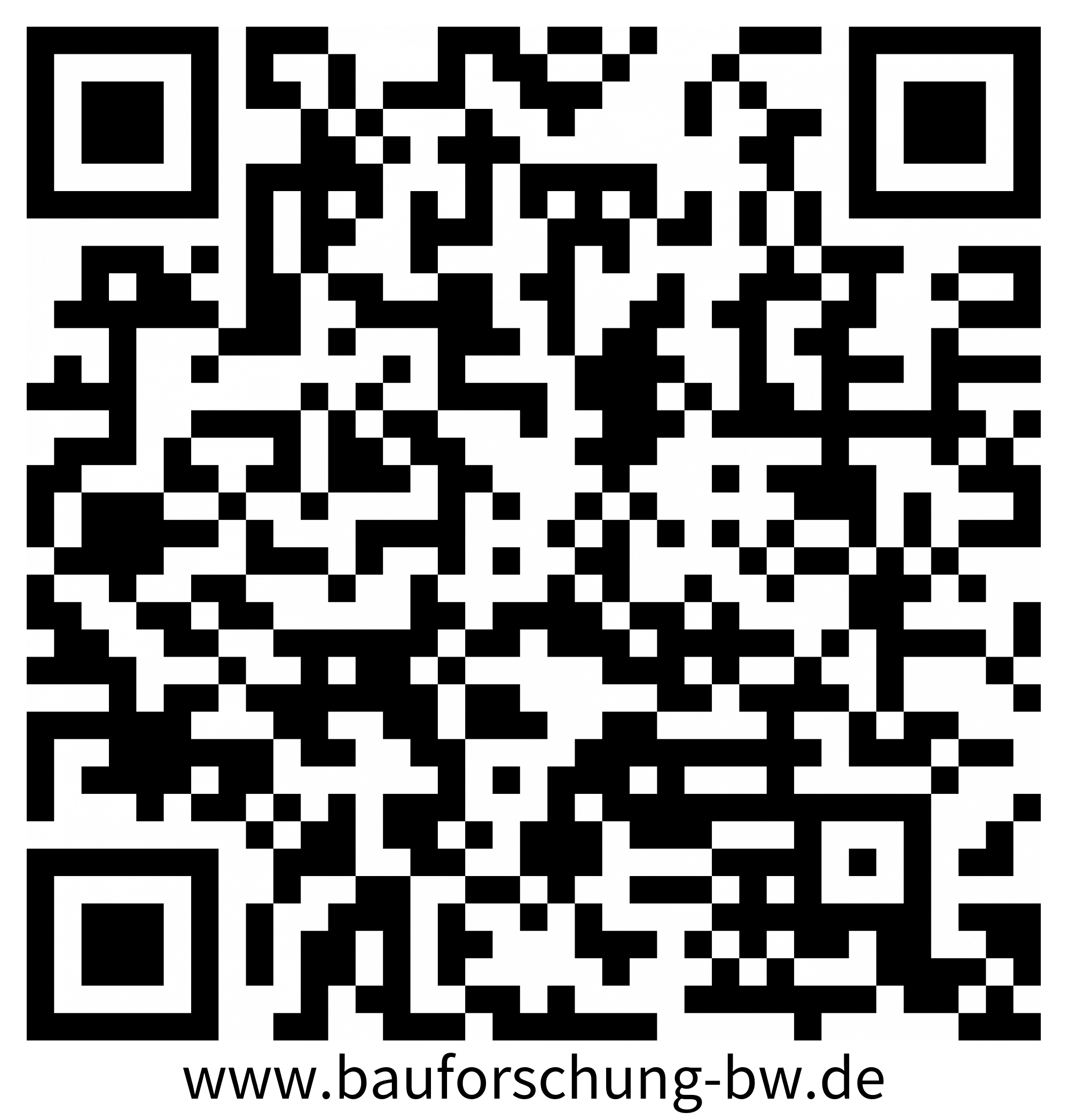Hopfenscheune
ID:
105010920219
/
Datum:
04.08.2023
Datenbestand: Bauforschung
Datenbestand: Bauforschung
Objektdaten
| Straße: | Wittumstraße |
| Hausnummer: | 32 |
| Postleitzahl: | 71120 |
| Stadt-Teilort: | Grafenau - Döffingen |
|
|
|
| Regierungsbezirk: | Stuttgart |
| Kreis: | Böblingen (Landkreis) |
| Wohnplatzschlüssel: | 8115054003 |
| Flurstücknummer: | keine |
| Historischer Straßenname: | keiner |
| Historische Gebäudenummer: | keine |
| Lage des Wohnplatzes: |

|
Kartenansicht (OpenStreetMaps)
Durch Ihre Cookie-Auswahl haben Sie die Kartenansicht deaktiviert, die eigentlich hier angezeigt werden würde. Wenn Sie die Kartenansicht nutzen möchten, passen Sie bitte Ihre Cookie-Einstellungen unter Impressum & Datenschutzerklärung an.
Ehem. Zehntscheune, Dätzinger Straße 74 (71120 Grafenau-Döffingen)
Bauphasen
Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:
Die Hopfenscheune wurde 1854 (d) errichtet. Mit der Neunutzung als normale landwirtschaftliche Feldscheune gingen bauliche Maßnahmen im Verlauf des 20. Jahrhunderts einher. Im späten 20. bzw. zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurden Schäden am Dachwerk repariert.
1. Bauphase:
(1853 - 1854)
(1853 - 1854)
An der Stelle des heutigen Gebäudes Wittumstraße 32 war in der Urkarte der Landesvermessung Württemberg im Jahr 1830 noch keine Bebauung vorhanden.
Das Gebäude datiert dendrochronologisch auf Winter 1853/54( d). Es wurde demnach wohl im Jahr nach der letzten dokumentierten Bauholzfällung errichtet, also vermutlich 1854. Das Gebäude erinnert mit seinen zwei Tennen und zwei Barnen an historische Zehntscheunen. Es handelt sich aber definitiv nicht um eine Zehntscheune, da diese im Zuge der Zehntablösung ab 1848 überflüssig wurden und in anderen württembergischen Dörfern vielfach verkauft, aber natürlich nicht neu gebaut wurden. Nach Auskunft der noch lebenden Vorbesitzerin wurde das Gebäude ursprünglich als Hopfenscheune erbaut. Diese Sondernutzung dürfte vermutlich zum einen im kurzzeitigen Einlagern der geernteten Hopfenreben in den beiden Barnen, zum zweiten dem witterungsgeschützten Zupfen der Hopfendolden in den beiden Tennen und schließlich zum dritten dem Trocknen der Hopfendolden auf den Lagerböden im OG und DG bestanden haben. Ob darüber hinaus noch über längere Zeiträume die getrockneten Hopfendolden in Säcken in der Scheune gelagert waren, ist nicht sicher. Jedenfalls deutet sich damit an, dass die Scheune über längere Zeiträume wohl nur saisonal genutzt war.
Das Gebäude datiert dendrochronologisch auf Winter 1853/54( d). Es wurde demnach wohl im Jahr nach der letzten dokumentierten Bauholzfällung errichtet, also vermutlich 1854. Das Gebäude erinnert mit seinen zwei Tennen und zwei Barnen an historische Zehntscheunen. Es handelt sich aber definitiv nicht um eine Zehntscheune, da diese im Zuge der Zehntablösung ab 1848 überflüssig wurden und in anderen württembergischen Dörfern vielfach verkauft, aber natürlich nicht neu gebaut wurden. Nach Auskunft der noch lebenden Vorbesitzerin wurde das Gebäude ursprünglich als Hopfenscheune erbaut. Diese Sondernutzung dürfte vermutlich zum einen im kurzzeitigen Einlagern der geernteten Hopfenreben in den beiden Barnen, zum zweiten dem witterungsgeschützten Zupfen der Hopfendolden in den beiden Tennen und schließlich zum dritten dem Trocknen der Hopfendolden auf den Lagerböden im OG und DG bestanden haben. Ob darüber hinaus noch über längere Zeiträume die getrockneten Hopfendolden in Säcken in der Scheune gelagert waren, ist nicht sicher. Jedenfalls deutet sich damit an, dass die Scheune über längere Zeiträume wohl nur saisonal genutzt war.
Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)
- Untergeschoss(e)
- Ausstattung
Lagedetail:
- Einzellage
- allgemein
Bauwerkstyp:
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Scheune mit Sondernutzung
Konstruktionsdetail:
- Mischbau
- Unterbau aus Stein (gestelzt)
2. Bauphase:
(1900 - 1980)
(1900 - 1980)
Im Verlauf des 20. Jahrhunderts wurden die bauzeitlichen Bretterbodenbeläge weitgehend entfernt und durch neue Bretterböden bzw. im OG nur durch eingelegte unbefestigte Schwartenbretter ersetzt. Der genaue Zeitpunkt dieser Maßnahme ist nicht bekannt. Zudem wurde im EG jeweils die nordwestlichen Zonen der Querwände entfernt, um die Barne für landwirtschaftliche Fahrzeuge oder Anhänger befahrbar zu machen. Diese Maßnahme dokumentiert auch den Übergang von der ursprünglichen Nutzung als Hopfenscheuer zu einer normalen landwirtschaftlichen Feldscheuer hin. Der Zeitpunkt dieser Maßnahme ist ebenfalls nicht näher bekannt.
Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)
Lagedetail:
- Siedlung
- Dorf
Bauwerkstyp:
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Scheune
3. Bauphase:
(1980 - 2022)
(1980 - 2022)
Insbesondere im Dachwerk wurden im späten 20. bzw. frühen 21. Jahrhundert vorhandene Schäden durch rein funktionale Reparaturmaßnahmen behoben. Zudem wurden die beiden Giebelfassaden mit einer Schalung aus Nut-und-Feder-Brettchen verkleidet.
Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)
- Ausstattung
Zugeordnete Dokumentationen
- Bauaufnahme und Bauhistorische Untersuchung
Beschreibung
Umgebung, Lage:
Die Hopfenscheune Wittumstraße 32 liegt nordöstlich außerhalb des historischen Dorfkerns von Döffingen. Zum Dorfkern hin schließen weitere Gebäude des 19. Jahrhunderts an, während in die anderen Richtungen Neubauten des späteren 20. Jahrhunderts mittelbar benachbart sind. Das Gebäude steht traufständig etwa 8,5 m zurückgesetzt an der Südostseite der Wittumstraße, die hier in Richtung Nordosten den Hang hinauf führt.
Lagedetail:
- Siedlung
- Dorf
Bauwerkstyp:
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Scheune mit Sondernutzung
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):
Es handelt sich bei dem Gebäude um einen Riegelbau mit zweigeschossigem Satteldach. Der Traufbau besteht aus einem massiven Erdgeschoss und in der Südwesthälfte einem ebensolchen Untergeschoss sowie einem Oberstock in Fachwerkbauweise aus Eichenholz. Mit Ausnahme der Werksteinquader und Werksteingewände an der Schauseite zur Straße hin ist das ganze Gebäude verputzt und an den Giebelseiten zudem mit einer jungen Brettschalung verkleidet.
Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:
Zonierung:
Das Gebäude ist im EG und OG in vier Querzonen und drei Längszonen unterteilt, im 1. DG jedoch nur in zwei Längszonen. Im UG befindet sich unter der südwestlichsten Querzone eine Remise und unter der daran anschließenden zweiten Querzone ein Gewölbekeller. Im EG sind die beiden mittleren Querzonen als Tennen ausgebildet, während die beiden giebelseitigen Querzonen als Barn abgetrennt sind. Die Erschließung der Tennen und der Remise erfolgt durch annähernd rundbogig überfangene Tore an der straßenseitigen Nordwesttrauffassade. Die innere Erschließung erfolgt durch je eine Treppe in beiden Tennen ins OG, von dort aber nur noch mit je einer Treppe ins 1. DG und ins 2. DG. Zudem befindet sich über beiden Tennen jeweils ein großes Aufzugsloch in den Balkenlagen bis ins 2. DG hinauf.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):
Vorhandene Schäden insbesondere im Dachwerk wurden im späten 20. bzw. frühen 21. Jahrhundert durch rein funktionale Reparaturmaßnahmen behoben.
Bestand/Ausstattung:
An historischer Ausstattung sind neben den bauzeitlichen Treppen insbesondere die drei bauzeitlichen doppelflügligen Wendebohlentore hervorzuheben.
Konstruktionen
Konstruktionsdetail:
- Gewölbe
- Tonnengewölbe
- Dachgerüst Grundsystem
- Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
- Detail (Ausstattung)
- bemerkenswerte Türen
Konstruktion/Material:
keine Angaben