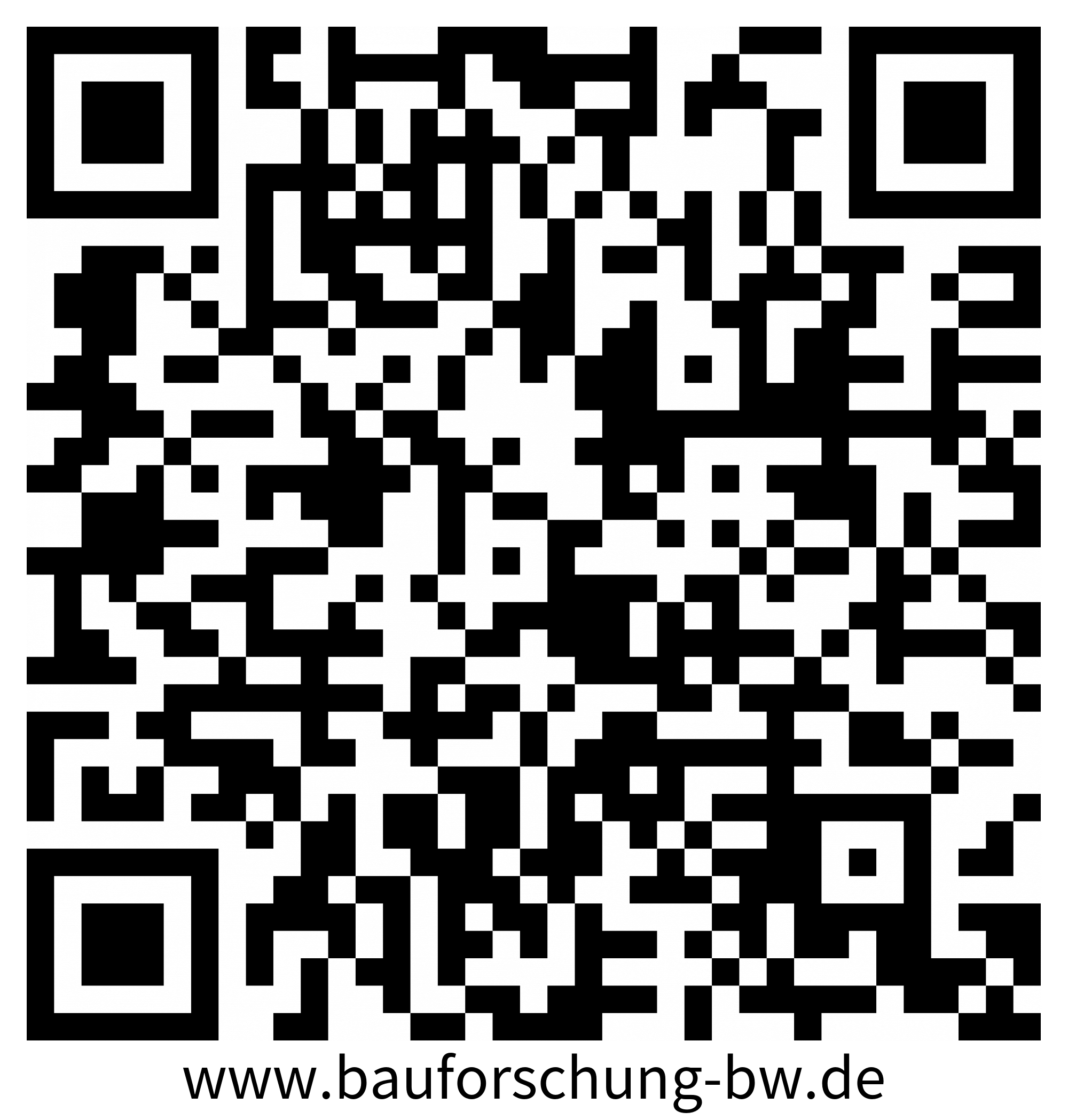Vogtshaus
Datenbestand: Bauforschung
Objektdaten
| Straße: | Hauptstraße |
| Hausnummer: | 63 |
| Postleitzahl: | 88339 |
| Stadt-Teilort: | Bad Waldsee |
|
|
|
| Regierungsbezirk: | Tübingen |
| Kreis: | Ravensburg (Landkreis) |
| Wohnplatzschlüssel: | 8436009005 |
| Flurstücknummer: | keine |
| Historischer Straßenname: | keiner |
| Historische Gebäudenummer: | keine |
| Lage des Wohnplatzes: |

|
| Geo-Koordinaten: | 47,9211° nördliche Breite, 9,7523° östliche Länge |
Kartenansicht (OpenStreetMaps)
Wohnhaus, Entenmoos 29 (88339 Bad Waldsee)
Gasthaus zur Stadt, Hauptstraße 49 (88339 Bad Waldsee)
Wohn- und Geschäftshaus (88339 Bad Waldsee, Wurzacher Straße 4)
Bauphasen
Um 1480 (d) errichtetes dreigeschossiges Gebäude unter zweigeschossigem Satteldach. Es diente, soweit nachvollziehbar, ursprünglich als Vogts- oder Amtshaus der Truchsesse von Waldburg.
Ab 1681 städtisch, ab 1683 spätestens 1690 Gästehaus des Franziskanerinnenklosters.
Ab 1782 städtische Schule, ab 1856 in Besitz einer Wachszieherfamilie. Seitdem in Privatbesitz.
Keller, EG und die beiden Obergeschosse im Kern mittelalterlich. Das Dach 1670 (d) unter Beibehaltung der spätmittelalterlichen Dachbalkenlage über darübergelegten Schwellen und zweiter Dachbalkenlage neu errichtet, ebenso die beiden Giebel. Die Umfassungswände in Keller und EG zum Großteil Bruchstein bzw. Mischmauerwerk. In den Obergeschossen später vermauerte "Sparbögen" an beiden Traufseiten nachweisbar.
Im Keller Eichenbalkendecke in Querlage, im EG Längsbalkenlage, in den Obergeschossen Querbalkenlage, Dendrodatierungen der Deckenbalken: Keller: Winter 1479/80 (Eiche), über EG und 1. OG: Sommer 1474 (Tannen) und über dem 2. OG (= alte Dachbalkenlage): Sommer 1477 (Tanne). In Keller und EG möglicherweise Integration älteren Mauerwerks in den Neubau der 1480er Jahre. Im ursprünglich wohl drei-, heute nurmehr zweischiffigen Keller eine stark dimensionierte Stütze, darüber eingehalst ein wohl nachträglich eingebrachter Längsunterzug. Darauf aufsitzend (wohl in durch Unterzugeinbau veränderter Situation) eine EG-Stütze.
Im konstruktiv ursprünglich längs und quer in drei Zonen unterteilten EG bauzeitlich eine Halle mit zwei doppelten Querunterzügen über vier Holzstützen. Davon zwei erhalten, die anderen beiden durch Mauerwerk ersetzt. In der östlichen Längszone eine starke Bruchsteinquerwand mit später eingebrachtem oder zumindest erweitertem Bogen in der Querbundachse.
In den Obergeschossen bleibt eine Beurteilung der älteren Phasen aufgrund des hochwertigen und fast komplett erhaltenen Verkleidungszustands des beginnenden 20. Jh. im Spekulativen. Erhalten blieb eine ältere Gliederung hauptsächlich in den Zwischenböden über den abgehängten Decken. Soweit ablesbar auch hier eine Teilung jeweils in drei Längs- und drei Querzonen (in den Geschossen nicht lotrecht übereinander). Im NO jeweils ein größerer Eckraum (wohl auch beim Ursprungsbau, da durch die älteren Längsbünde in den Zwischendecken nachweisbar). Soweit ersichtlich Versprung der westlichen Längsbundachse auf Höhe des ersten Querbunds von Süden in Richtung Osten in die heutige Flurwand. In der mittleren Querzone zwischenzeitlich in einer Erweiterung des Flures nach Westen der Erschließungsraum vom EG aus und Küchennutzung im 2. OG. Diese wurde später in die östliche Längszone verlegt.
Im NO-Raum im 2. OG Erhalt einer bauzeitlichen Bohlenwand, diese innen später mit senkrechten Brettern verkleidet.
Aus der Zeit der Schulnutzung lassen sich entlang der Nordseite in beiden Obergeschossen je ein großer Schulsaal nachweisen. Sie wurden später in beiden Geschossen durch Trennwände in je drei Räume unterteilt. Zwei Schulsäle werden neben drei Lehrerwohnungen auch in der Literatur genannt. (vgl. Auswertung Barczyk)
Zwischenzeitliche Erschließungen der Obergeschosse konnten am Bestand nachgewiesen werden, eine bauzeitliche Erschließung bleibt bislang unter der zu schützenden Verkleidung verborgen.
Die dem heutigen Bau sein maßgebliches Erscheinungsbild gebende Umbaumaßnahme fand im frühen 20. Jh. statt. Terrazzo- und Fliesenböden, Türblätter und abgehängte Stuckdecken (z. T. mit Jugendstilornamenten) blieben aus der Zeit erhalten. Ebenso stellt sich das äußere Erscheinungsbild mit Zieraufsätzen über den Fenstern und Masken an der Nordfassade als Gestaltung unter der Wachszieherfamilie Albrecht im frühen 20. Jh. dar.
Das heute einheitliche Erscheinungsbild birgt eine Vielzahl an z. T. noch ablesbaren Veränderungen zur Nutzung als Gästehaus und Schule. (z. B. Saal, frühere Küchennutzung, zwischenzeitliche Erschließung und frühere Kaminstandorte).
(1480)
(1670)

- Dachgeschoss(e)
- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus
- Dachgerüst Grundsystem
- Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
(1690)

- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)
(1782)

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft
- Schule, Kindergarten
(1900)

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Ausstattung
- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus
Zugeordnete Dokumentationen
- Bauhistorische Untersuchung
Beschreibung
- Siedlung
- Stadt
- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus
Zonierung:
Konstruktionen
- Mischbau
- Steinbau mit Gebäudeteilen aus Holz
- Verwendete Materialien
- Holz
- Stein
Längsbalkenlage im EG und Querbalkenlage in den Obergeschossen. Im Keller Eichenbalkenlage. Z. T. Vormauerungen unter "Sparbögen" in den Obergeschossen entlang der Traufseiten und ersetzte Wandpartien (an der südlichen Giebelseite vor allem). Durch erhaltenswerte Oberflächen aus der Zeit um 1900 bleibt eine genauere Differenzierung der Materialien und maßgenaue Kartierung derselben anhand von Befundöffnungen zum jetzigen Zeitpunkt weitgehend verwehrt. Bei späteren baulichen Veränderungen und Substanzeingriffen wären baubegleitend weitere Befunde aufzunehmen.