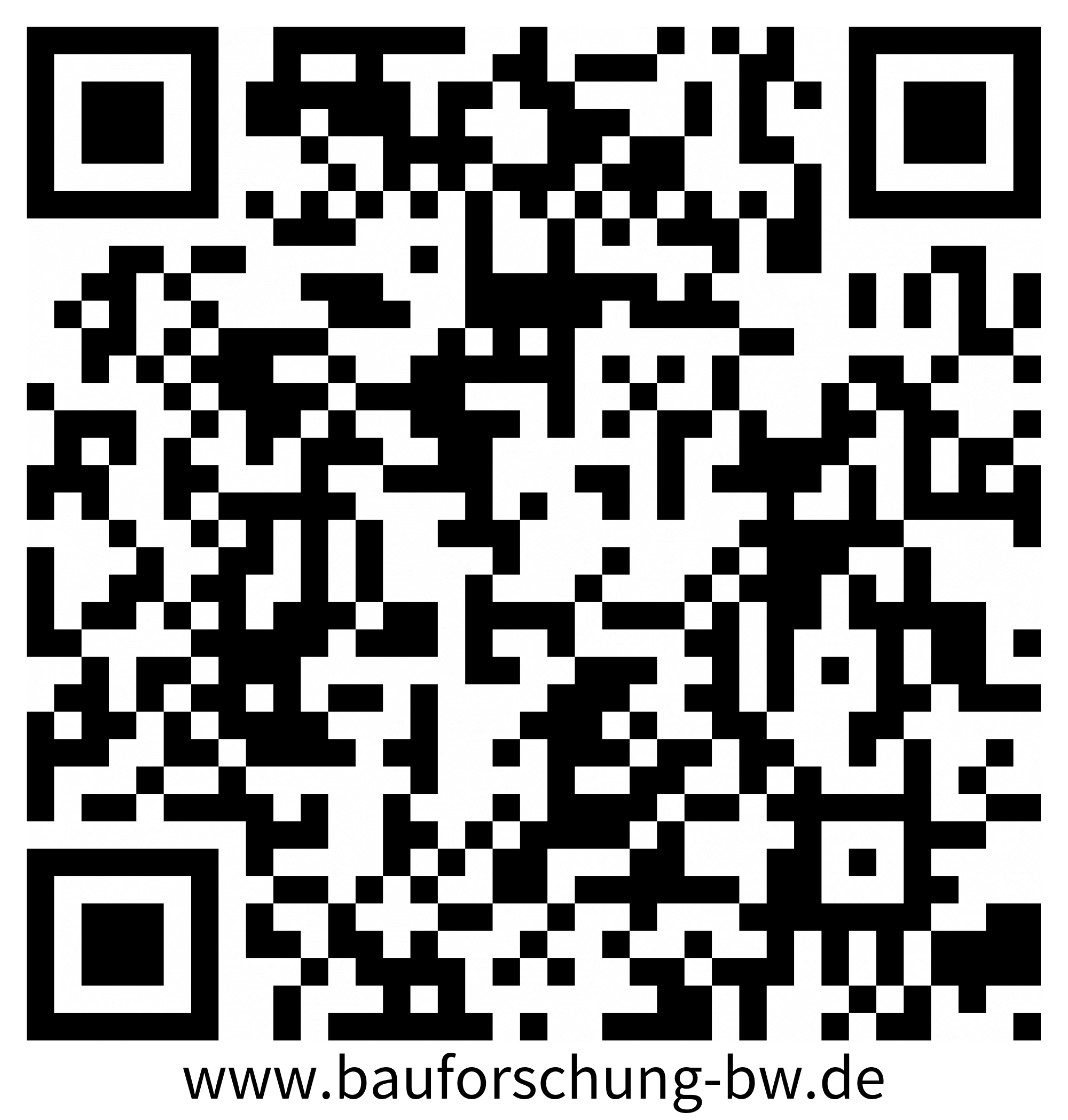Wohnhaus
Datenbestand: Bauforschung
Objektdaten
| Straße: | Oberamtsstraße |
| Hausnummer: | 14 |
| Postleitzahl: | 73479 |
| Stadt-Teilort: | Ellwangen |
|
|
|
| Regierungsbezirk: | Stuttgart |
| Kreis: | Ostalbkreis (Landkreis) |
| Wohnplatzschlüssel: | 8136019012 |
| Flurstücknummer: | keine |
| Historischer Straßenname: | keiner |
| Historische Gebäudenummer: | keine |
| Lage des Wohnplatzes: |

|
Kartenansicht (OpenStreetMaps)
ehem. Stiftsherrenhaus (73479 Ellwangen, Apothekergasse 3)
Handwerkerhaus (73479 Ellwangen, Hafnergasse 5)
ehem. Nikolauspflege (73479 Ellwangen, Hallerstraße 9)
Wohn- und Geschäftshaus (73479 Ellwangen, Marienstraße 15)
Wohnhaus, Marienstraße 1 (73479 Ellwangen)
Wohn- und Geschäftshaus (73479 Ellwangen, Marienstraße 22)
Wohn- und Geschäftshaus, Marktplatz 13 (73479 Ellwangen)
Kapitularhaus, Marktplatz 21 (73479 Ellwangen)
evangelische Stadtkirche (Jesuiten) (73479 Ellwangen, Marktplatz 5)
Wohnhaus, Oberamtsstraße 9 (73479 Ellwangen)
Wohn- und Geschäftshaus (73479 Ellwangen, Pfarrgasse 10)
Wohnhaus, Pfarrgasse 18 (73479 Ellwangen)
Wohn- und Geschäftshaus, Pfarrgasse 4 (73479 Ellwangen)
Wohn- und Geschäftshaus (73479 Ellwangen, Pfarrgasse 8)
Chorherrenstift - Ostflügel (73479 Ellwangen, Philipp-Jeningen-Platz 2)
Ehem. Statthalterei (73479 Ellwangen, Philipp-Jeningen-Platz 4)
Bauphasen
Das Gebäude Oberamtsstraße 14 in Ellwangen wurde 1446 (d) erbaut. Aus dieser Zeit haben sich im wesentlichen der Gewölbekeller, die massiven Außenwände der Vollgeschosse, die Holzbalkendecken
sowie das Dachtragwerk erhalten. Vereinzelt konnten bauzeitliche Innenwände mit Lehm-Flechtwerkausfachung nachgewiesen werden. An den Innenseiten der Außenwände konnten - möglicherweise bauzeitliche - Farbfassungsreste mit sehr kräftigem Rotton aufgedeckt werden. Im 18. Jahrhundert fanden größere Umbau- und Umgestaltungsmaßnahmen am Gebäude statt. Sowohl am äußeren Erscheinungsbild als auch im Inneren wurde eine durchgreifende Barockisierung verwirklicht, die sich sehr schön an zahlreichen Ausstattungselementen, wie Türen, Stuckierungen und dem Treppenlauf ablesen lässt. Besonders bemerkenswert ist die gut überlieferte barocke Sommerstube im 1. Dachgeschoss. Seit 1844 befindet sich das ehemals Hochfürstlich-Capitulische Amtshaus im Privatbesitz. Nun wurden diverse Umbauten vollzogen. Ein wesentlicher Eingriff war die Einrichtung bzw. Abtrennung einer zweiten Wohnung im Obergeschoss. Im Laufe des 20. Jahrhunderts und vor allem in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts fanden weitere, zumeist kleinere An- und Umbauten statt.
(1446)

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)
- Untergeschoss(e)
- Siedlung
- Stadt
- Wohnbauten
- Wohnhaus
(1693)
(1700 - 1799)

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)
(1804 - 1827)
(1844 - 1910)

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
(1953 - 1966)
errichtet. 1958 erfolgte der Badeinbau im Obergeschoss und 1966 wurde schließlich die südlich angebaute Garage errichtet. Darüber hinaus fanden noch kleine Ausbesserungsmaßnahmen und Oberflächenerneuerungen statt.

- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)
Zugeordnete Dokumentationen
- Bauhistorische Kurzuntersuchung
Beschreibung
gegenüber des sog. Palais Adelmann, in zentraler Blickachse der Oberen Straße.
- Siedlung
- Stadt
- Wohnbauten
- Wohnhaus
- Öffentliche Bauten/ herrschaftliche Einrichtungen
- Amtsgebäude
Walmdach ab. Das Gebäude zeigt äußerlich eine barocke, symmetrisch geordnete Fassadengliederung, die mit vertieften Putzbändern und Lisenen zusätzlich akzentuiert wird.
Die Gebäudeerschließung erfolgt an der östlichen Seite über eine mittig zur Fassade angeordnete Außentreppe.
Zonierung:
haben muss. Die Grundrisszonierung des Wohnhauses besteht aus drei Querzonen, die im Erdgeschoss und vor allem am Dachtragwerk noch gut abzulesen sind. Die bauzeitliche Anzahl der Längszonen lässt sich heute nur noch schwer erkennen. Die heutige Teilung in drei
Längszonen, wobei die mittlere Zone die Mittellängsflurerschließung aufnimmt, dürfte der barocken Umbauphase entstammen. Das Erdgeschoss nimmt heute eine große Wohneinheit auf. Im Obergeschoss des Wohnhauses befinden sich zwei Wohneinheiten. Die drei Dachgeschossebenen sind weitestgehend unausgebaut und dienen zu Lagerzwecken. Lediglich im 1. Dachgeschoss sind mehrere Kammern durch Bretterwände abgetrennt. Diese Kammern
dienten einst als Knecht- bzw. Mägdekammern. Besonders bemerkenswert ist jedoch eine barocke Sommerstube mit Bretterleistendecke und barocker Zimmertüre.
Konstruktionen
- Decken
- Balkendecke
- Gewölbe
- Tonnengewölbe
- Dachgerüst Grundsystem
- Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
- Dachform
- Satteldach mit beidseitigem Vollwalm
- Detail (Ausstattung)
- bemerkenswerte Treppen
- bemerkenswerte Türen
- bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung
Längsrichtung. Abbundzeichen in Form von Strichkerben auf der Südseite und Quadratkerben auf der Nordseite, die eine Sparrenzählung belegen, konnten nachgewiesen werden. Eine einheitliche, zeitgleiche Errichtung des Dachtragwerkes ist aufgrund der Gefügemerkmale als gesichert anzusehen. Deutlich zu erkennen ist die nachträgliche Abwalmung der Ost- und Westseite. Hier wurden die Pfetten abgesägt und nachträglich durch Stützen gesichert. Die Konstruktion der Walmdächer ist verzapft und nimmt keinen Bezug zum mittelalterlichen Dachtragwerk. Der Rest einer Haspelhalterung im 2. Dachgeschoss spricht dafür, dass zumindest an der Ostseite ein Giebelwanddreieck mit Aufzugsladen vorhanden war. Die dendrochronologische Altersbestimmung des Dachtragwerkes ergab ein Fälldatum der Hölzer im Winter 1445/46, so dass von einer Erbauung des Gebäudes im Jahr 1446 ausgegangen werden kann.